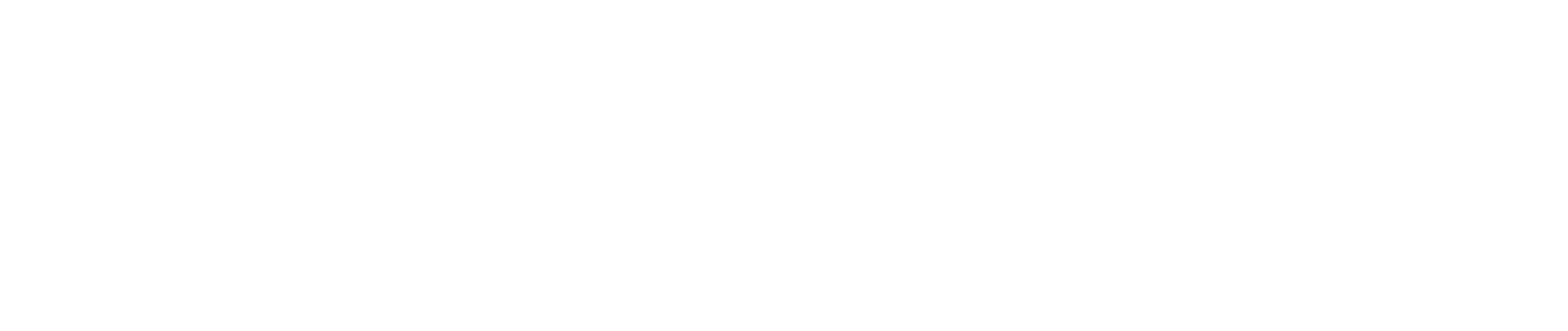Bildquelle
Kurze Erläuterung
Nachdem der schnelle Vormarsch der Deutschen Truppen zum Stehen gekommen war und sich der Konflikt Ende 1914 zum Stellungskrieg wandelte, wuchs die Bedeutung der Wirtschaft an der Heimatfront. Langfristig würde die Kriegspartei siegen, die die meisten industriellen Ressourcen mobilisieren würde. Zugleich ging die Produktionskapazität von Fabriken und Bergwerken, die als Energielieferant unerlässlich waren, zurück, weil ein Großteil der Arbeiter zum Kriegsdienst beordert wurden. An vielen Arbeitsplätzen, die eigentlich als Männerjobs galten, wurden nun Frauen sowie Kinder und Jugendliche eingesetzt. Nach Ende des Krieges wurden die meisten Frauen allerdings wieder entlassen, um die Arbeitsplätze wieder für die heimkehrenden Männer frei zu machen. Dies verlief jedoch nicht unproblematisch, da viele Frauen ihre gestärkte Position nicht aufgeben wollten.
Die Fotos stammen aus der Sammlung der Recklinghäuser Gymnasialdirektors Joseph Schäfer (1867-1938), der unter anderem das Leben der Recklinghäuser Bevölkerung während des Ersten Weltkriegs dokumentiert. Mehr Informationen zu der Sammlung finden sich im Bildarchiv.
Relevanz des Materials
An der Fotografie lassen sich neue Rollenbilder erarbeiten. Aus der kriegsbedingten Not heraus mussten Frauen ehemals männerdominierte Arbeitsplätze besetzen. Im Rahmen des Krieges sollten sie so die Arbeitskraft der Industrie erhalten und die Produktion kriegswichtiger Güter sicherstellen. So wurde den Frauen aus Gründen des Mangels an Arbeitskräften eine neue Rolle in einer bisher patriarchalisch geprägten Gesellschaft zuteil, an die auch neue Erwartungen geknüpft waren. Diese neue Rolle als Arbeiterin, auf der große finanzielle Verantwortung lag, war auch wegweisend für das Frauenbild in der Weimarer Republik, wo Frauen eine deutlich gestärkte Position hatten und sich auch durch die aus dem Krieg zurückkehrenden Männer nicht mehr so leicht zurückdrängen ließen. Im Nationalsozialismus wurde dann wieder ein stärker konservatives Frauenbild propagiert und Frauen zunächst wieder aus dem Arbeitsleben verdrängt, bis sie im Laufe des Zweiten Weltkriegs wieder stärker in die Kriegswirtschaft eingebunden wurden. Diese Fotografie steht somit sinnbildlich für Veränderungen in Bezug auf die Rolle von Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft, die beschleunigt worden sind durch die Umstände und Erfordernisse einer im Kriegszustand befindlichen Gesellschaft.
Daniel Sobanski
Lernort
Als Kultur- und Bildungseinrichtung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) hat das LWL-Medienzentrum für Westfalen den dreifachen Auftrag, das audiovisuelle Erbe der Region zu sichern (Bild-, Film- und Tonarchiv), die Geschichte und Gegenwart Westfalens mediengestützt zu dokumentieren und zu vermitteln (Medienproduktion) und das Lernen in der digitalen Welt in Schulen und außerschulischer Bildung zu unterstützen (Medienbildung und -bereitstellung).