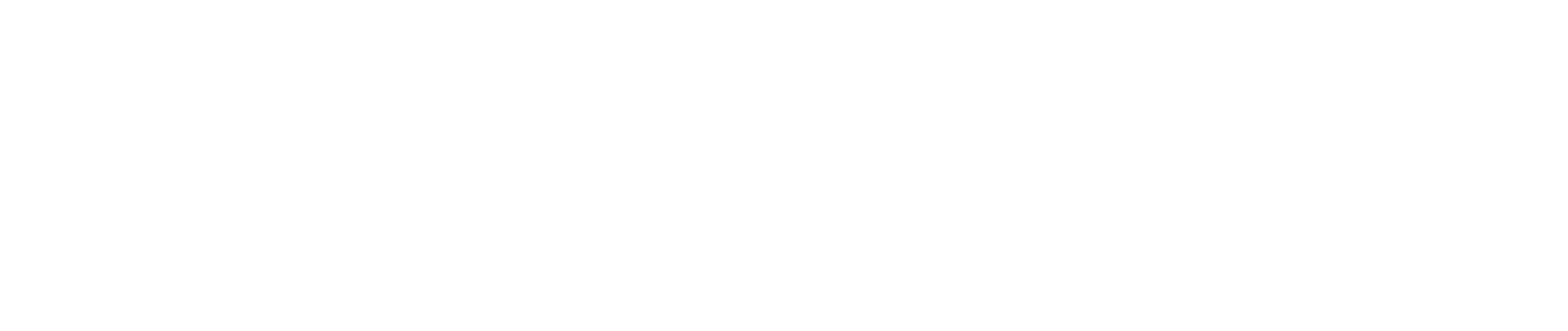Textquelle
Kurze Erläuterung
Der Friedensvertrag von Osnabrück ist einer von zwei Verträgen und Teilen des sog. „Westfälischen Friedens“. Die Friedensverhandlungen haben in Osnabrück und Münster stattgefunden, wobei die Vertreter der Kriegsparteien aufgeteilt wurden: In Osnabrück verhandelten die Schweden und Ferdinand III. als Kaiser der Heiligen Römischen Reiches, während in Münster die Verhandlungen zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich abgehalten wurden.
In den Friedensverträgen wurden neben der Festlegung des Waffenstillstands auch Regelungen darüber getroffen, wie mit den besetzten Gebieten weiter zu verfahren sei und welche Reparationsleistungen (Entschädigungszahlungen etc.) an die unterschiedlichen Landesherrinnen und Landesherren zu entrichten sind. Die Konsequenzen bei einer Nichtbeachtung dieser Regelungen wurden ebenfalls schriftlich festgehalten.
Die in diesen Friedensverträgen geschlossenen und verfassungsgebenden Entscheidungen waren Grundlage für die Verfassungsordnung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation bis 1806. Sie führten insgesamt zu einer Stabilisierung der Situation auf dem europäischen Festland.
Relevanz des Materials
An dem Auszug aus dem Osnabrücker Friedensvertrag lassen sich exemplarisch an einer Region die Auswirkungen und Folgen des Friedensvertrags ablesen. So wird hier genau festgelegt, welche Städte weiter besetzt werden dürfen und welche Entschädigungssummen – in diesem Auszug an die Landesherrin von Hessen – zu richten sind.
Joel Wichary
Lernort
Als Kultur- und Bildungseinrichtung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) hat das LWL-Medienzentrum für Westfalen den dreifachen Auftrag, das audiovisuelle Erbe der Region zu sichern (Bild-, Film- und Tonarchiv), die Geschichte und Gegenwart Westfalens mediengestützt zu dokumentieren und zu vermitteln (Medienproduktion) und das Lernen in der digitalen Welt in Schulen und außerschulischer Bildung zu unterstützen (Medienbildung und -bereitstellung).