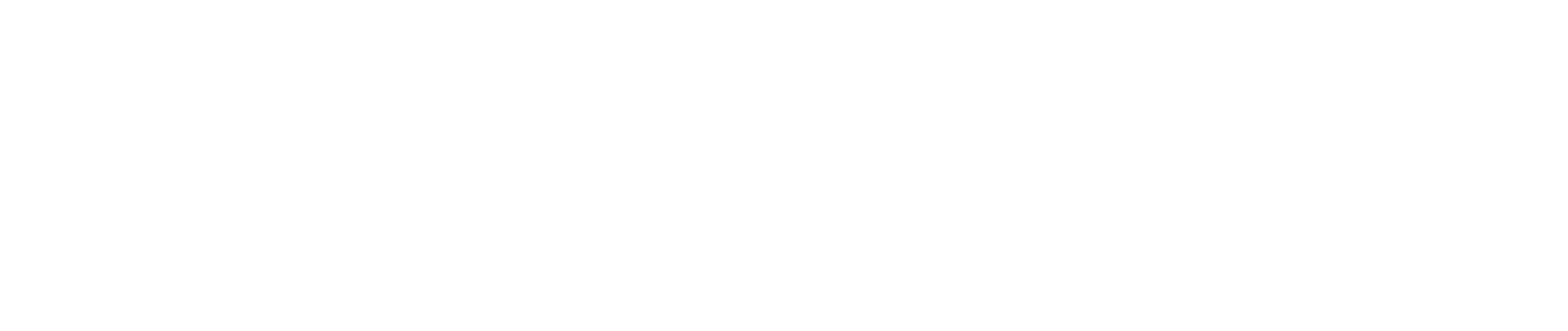Textquelle
Kurze Erläuterung
Das Deutsche Reich sah in den Ländern Afrikas und Asiens viele wirtschaftliche Möglichkeiten. Die Kolonien waren dabei für die deutsche Wirtschaft Absatzmärkte, Märkte für Investitionen und Lieferanten von Rohstoffen, die in Europa nicht vorkamen oder angebaut werden konnten. Um Kabel für das Stromnetz – elektrischer Strom gewann zum Ende des 19. Jahrhunderts eine größere Bedeutung – herstellen zu können, benötigte man große Mengen an Kupfer, das z.B. in Afrika vorkam. Außerdem setzte das Automobil zu seinem Siegeszug an. Dadurch wuchs der Bedarf an Kautschuk für Reifen und Leitungen und Erdöl als Treibstoff.
Sogenannten Kolonialwaren wie Kaffee, Tee, Kakao, Reis oder Tabak waren in der Bevölkerung beliebt und sollten zu möglichst geringen Preisen angeboten werden. Waren hierfür stammten nicht nur von afrikanischen Kolonien, sondern auch aus dem heutigen China: Dort hatten deutsche Truppen die Kiautschou-Bucht (heute: Jiaozhou) mit der Hafenstadt Quingdao (eingedeutscht: Tsingtau) – im Nordosten des heutigen China – 1897 unter einem Vorwand besetzt. Das Deutsche Reich pachtete das Gebiet anschließend und errichtete einen Marinestützpunkt. Dieser sollte zudem als deutsche „Musterkolonie“ operieren und als internationales Beispiel effizientem „Deutschtums“ den Anspruch des Deutsches Kaiserreichs auf einen „Platz an der Sonne“ untermauern.
Relevanz des Materials
Das Oberpräsidium in Münster, die höchste Verwaltungsbehörde der Provinz Westfalen, befasste sich mit den Entwicklungsmöglichkeiten des Flottenstützpunkts in Kiautschou. Die Regierung in Münster untersuchte, wie sich die westfälische Wirtschaft gewinnbringend in der neuen Musterkolonie engagieren konnte. Dazu beschaffte sich die Verwaltung eine Liste von Produkten, die das Deutsche Reich aus den Kolonien bezog. Die Liste wurde vom Institut Linnea in Berlin erstellt; einem Hersteller von naturhistorischen Lehrmitteln. Die Liste zeigt eine ganze Reihe von Produkten, von denen viele für uns heute alltäglich sind, die aber einen kolonialen Hintergrund haben. Dazu zählen Produkte wie Kaffee und Kakao, Erdnüsse und eine Reihe von Gewürzen wie Nelken, Muskatnüsse und Vanille. An der Münsteraner Liste lassen sich demnach regionale Verflechtungen in Kolonialbestrebungen erarbeiten. Die Liste unterstreicht zudem die Allgegenwärtigkeit kolonialer Produkte.
Daniel Sobanski / Andrea Lorenz
Lernort
Das Landesarchiv NRW verwahrt an seinen drei Standorten Duisburg, Detmold und Münster historische Dokumente aus der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Die Abteilung Westfalen des Landesarchivs NRW entstand im Jahre 1829 als „Königliches Provinzialarchiv“ in Münster. Hier wurden Archivalien der aufgelösten alten Territorien und der säkularisierten Klöster der preußischen Provinz Westfalen zusammengeführt. Diese waren zuvor an verschiedenen Stellen des Landes in „Archivdepots“ gesammelt worden, um sie vor Zerstreuung und Verlust zu retten. Nach der Entstehung des Landesarchiv NRW 2004 wurde das Staatsarchiv Münster 2008 zur Abteilung Westfalen.
Hier werden nun Archivalien aus 12 Jahrhunderten verwahrt: rund 100.000 Urkunden, 36 Kilometer Akten, 80.000 Karten und Pläne, 3.400 Aufschwörungstafeln, 2.000 Handschriften, 4.500 Plakate, 2.000 Bilder und Fotos, sowie Elektronisches Archivgut. Eine Nutzung ist sowohl im Lesesaal als auch online möglich. Für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer steht unser Archivpädagoge als Ansprechpartner bereit.